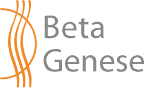Eine dissoziative Störung zeichnet sich aus durch einen teilweisen oder völligen Verlust der Fähigkeit unseres Gehirns, Wahrnehmungen zu einem normalen, vollumfänglichen Erleben zusammenzufügen. Die Symptome reichen von dissoziativer Amnesie, also einem Verlust der Erinnerungen, über Bewegungsstörungen wie Lähmungserscheinungen bis hin zu Krampfanfällen und Empfindungsstörungen.
In der BetaGenese Klinik für Psychosomatik und Psychiatrie in Bonn sind wir auf die Behandlung dissoziativer Störungen spezialisiert. Unser multiprofessionelles therapeutisches Team entwickelt gemeinsam einen individuellen psychologischen Therapieplan, der auf die spezifischen dissoziativen Symptome sowie individuelle Bedürfnisse abgestimmt ist.